Kennzahlenübersicht
Umsatz deutlich über Vor-Corona-Niveau, operatives Ergebnis wieder deutlich positiv.
Mehr erfahren
Die Pünktlichkeit im Schienenverkehr in Deutschland hat sich deutlich verringert.
Mehr erfahren
Im Rahmen unseres Klimaschutzziels für den DB-Konzern konnten wir im Berichtsjahr die spezifischen Treibhausgasemissionen weiter reduzieren.
Mehr erfahren
Auch 2022 haben wir den Anteil erneuerbarer Energien am DB-Bahnstrommix in Deutschland gesteigert.
Mehr erfahren
Externe Neueinstellungen in Deutschland (ohne Nachwuchskräfte)
Mehr erfahren










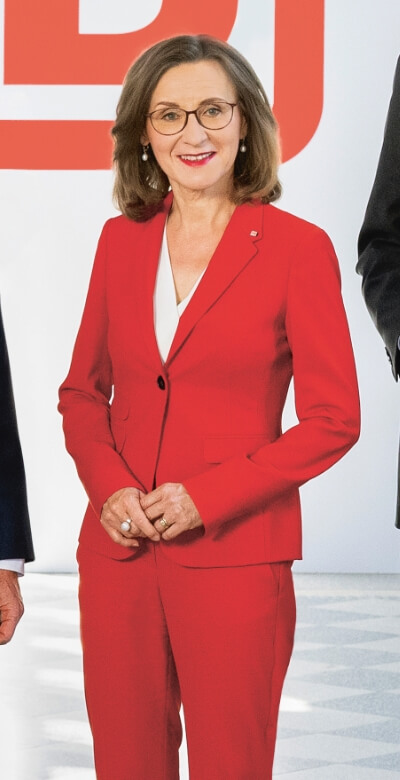
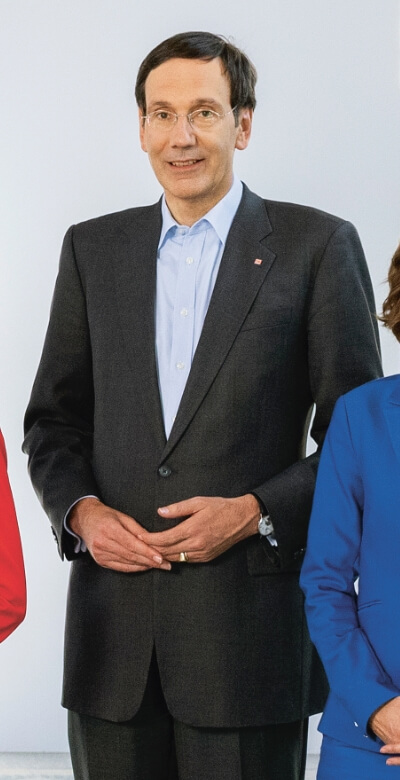










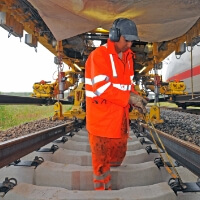








Mitarbeitendenzufriedenheit
Die Mitarbeitendenzufriedenheit wird alle zwei Jahre im Rahmen der Mitarbeitendenbefragung ermittelt ... mehr erfahren
Neueinstellungen
2022 haben im DB-Konzern in Deutschland rund 26.700 neue Mitarbeitende ihren ersten Arbeitstag absolviert ... mehr erfahren
Arbeit der Zukunft
Um unsere Innovationsfähigkeit zu stärken und uns zukunftssicher aufzustellen, wollen wir die Arbeit der Zukunft aktiv gestalten ... mehr erfahren
Diversity
Das Bekenntnis des DB-Konzerns zur Vielfalt seiner Mitarbeitenden ist in der Strategie Starke Schiene verankert ... mehr erfahren
Beschäftigungsbedingungen
Wir entwickeln Beschäftigungsbedingungen auf Basis aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen konsequent weiter ... mehr erfahren
Arbeitgeberattraktivität
Auch 2022 haben wir unsere Personaloffensive auf einem engen Arbeitsmarkt fortgesetzt ... mehr erfahren